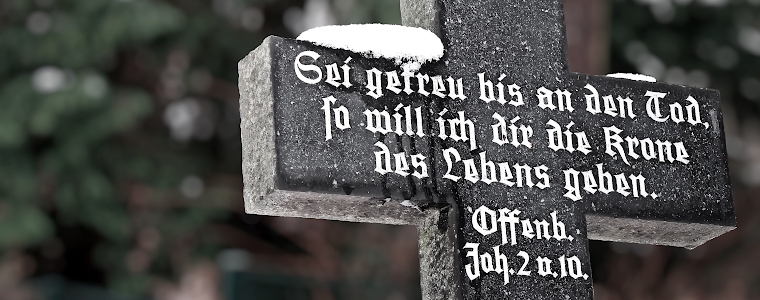Irgendwie ist mir der Tod schon immer ein fröhliches Faszinosum. Es ist ja nicht gerade so, dass ich ihn nicht abwarten könnte und klar, irgendwann wird der Kerl mit Sense auch bei mir anklopfen. Dumm nur, dass ich danach vielleicht nicht mehr darüber schreiben kann. Es muss so in den späten Siebzigern gewesen sein, als ich meine Mutter durch mein wiederholt plötzliches Verscheiden mehrfach in Schockstarre versetzte. Da war die Nummer mit dem Ketchup im Flur.
„Aaaahhhh!“ schallte es durch den Plattenbau. Ich lag darnieder, „blutete“ aus allen Ritzen und hatte nicht einmal letzte Worte für meine Familie übrig („… d-e-r Schatzzzzz l-i-e-g-t …). Meine Mutter rannte aus dem Zimmer, schlug die Hände vor das Gesicht und schrie „Juunngeeeee!“. Als der Schwindel auflog, bekam ich eine böse Ohrfeige und meine Mutter strafte mich sofortig mit den Worten: „Darüber macht man keinen Spaß – geh`mir aus den Augen!“.
Mein Einfallsreichtum hinsichtlich meiner Pseudotode kannte kaum Grenzen. Neben diversen Herzinfarkten und tödlichen Asthmaanfällen beim Abendbrot war das Wasser ein beliebtes Medium für einen spannenden Exitus. Trieb ich in Freibad und See noch als Wasserleiche an deren Oberfläche, so musste ich in der heimischen Badewanne schon kreativer werden. Ein mit viel Schaum getarnter Luftschlauch erhielt mich am Leben, während ich meine Eltern aus der Fassung brachte. Warum auch nicht? Schließlich waren große Unglücke und entsprechende Präventivmaßnahmen deren Dauerthemen zu Tische.
Wollte ich wirklich nur Aufmerksamkeit?
Diese Erklärung wäre zu einfach, interessierte ich mich doch tatsächlich schon früh für den irgendwie nicht greifbaren Tod. Wie ist das, „sterben“? Wie fühle ich mich dann? Nachts legte ich mich also auf den Rücken und starrte lange an die Zimmerdecke. Konnte ich mal kurz sterben? Nur mal so, nur mal gucken. Ich nahm also einen letzten großen Zug von dieser Weltenluft und stellte dann die Atmung ein. Jetzt noch die Hände auf der Brust falten und warten, was passieren würde. „Pahhhh“. Länger konnte ich nicht. In jenem Augenblick war ich einfach froh, meinen eigenen Tod gerade noch so überlebt zu haben. Ich dachte daran, irgendwann tot und damit „weg““ zu sein, zu allem Übel in Asche und Staub zu zerfallen – und bekam prompt Schlotterknie nebst Bruder Schweißausbruch. Schon komisch, dieser „Tod“.
Darf man über den Tod lachen?
Als in dieser Zeit der Stiefvater meiner Mutter starb und mein Vater ihr an einem Nachmittag die traurige Nachricht überbrachte, sah ich sie durch den Türschlitz in Tränen ausbrechen und zu Boden sinken. Ich versteckte mich gemeinsam mit meinem Bruder in einem Tipi unseres improvisierten Indianerlagers, welches wir im achteinhalb Quadratmeter – Kinderzimmer aufgebaut hatten. Mein Vater kam herein und erzählte uns das, was wir längst mitbekommen hatten. Schon in diesem Moment musste ich mir so auf die Zunge beißen, dass ich diesen fiesen Blutgeschmack bekam. Dabei war dieser Zungenbiss sehr wichtig, um nicht mächtig loslachen zu müssen.
Mein Opa erschien mir besonders des Nachts in meinen Träumen und versteckte sich bis dahin mit Vorliebe in einem Schrank. Familienmitglieder, die nach ihm starben, taten es ihm gleich. In diesen Jahren wandelte ich mich allerdings von einem „aktiven“ Toten in einen passiven Beobachter anderer Tode. Und es traf natürlich immer die Falschen, immer zu früh. Das dies auch andere so empfinden, wurde mir bei der Beerdigung meiner geliebten Großmutter klar. Der bestellte und bezahlte Redner sprach davon, dass uns Oma Frieda „plötzlich, unerwartet und viel zu früh“ verlassen habe. Meine Großmutter starb im zarten Alter von 92 Jahren.
Noch immer ereilt mich der Tod mehrfach im Jahr in meinen Gedanken, gibt sich dabei aber inzwischen wandlungsfähig. Mal sterbe ich auf dem Asphalt, mal in einem afrikanischen Krisengebiet. Neulich nickte ich ein wenig auf dem Sofa ein und dachte so bei mir, dass ich etwa noch X-Jahre habe, um dann unwiderruflich zu sterben. Und wieder war da der Tod, der ewige Staub, in den ich dann zerfallen würde.
Immerhin: Die meiste Zeit des Tages lebe ich noch.