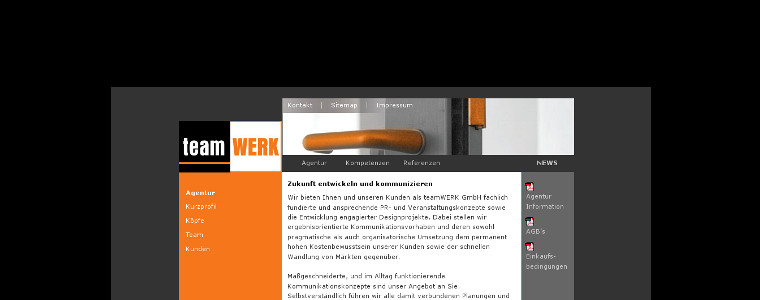Es war Ende der Neunziger, als Kohl fertig hatte und Rotgrün den Gesamtdeutschen einen grandiosen Neuanfang versprach. Der Autor des Beitrages musste feststellen, dass sein vermeintlich sicherer Job in einer staatlichen Kultureinrichtung nicht wirklich sicher war und irgendwie drehte sich ohnehin alles nur noch um das Internet und die sogenannten „Neuen Medien“.
Mein damaliger Arbeitgeber – ein Nationalmuseum – stand wegen „Umstrukturierung“ kurz vor dem Aus und ich suchte nach möglichen Alternativen. In den Jahren zuvor hatte ich bereits reichlich Praktika gesammelt und zahllose Stunden damit verbracht, die Tiefen der EBV (elektronische Bildverarbeitung) zu ergründen. Als ich dann im Museum ein paar Touchscreens mit Bildschirminhalten füllen durfte, kam der Umgang mit HTML (damals mein bevorzugtes Programm: „Alaire Homesite“ dazu.
Ich erinnere mich an eine Jobanzeige mit dem Titel „Kreativer Kopf gesucht“, auf die ich mich bewarb – und prompt den Job bekam. Überhaupt gab es in meinem näheren Arbeitsumfeld damals gefühlte einhundert Prozent Autodidakten, die – vielleicht gerade deshalb – ihren Job gut machten und die neue Medienwelt trotzdem nicht ins Chaos stürzten. Der Verdienst stimmte, das Arbeitsklima war ok. Sickerte während eines Projektes etwas technologisch Neues durch, wurde durchaus auch ein „Learning by Doing“ praktiziert – und niemand fand etwas komisch daran. Zugegeben, Spezialisten gab es schon immer. Man unterschied etwa zwischen klassischem „Grafiker“ (oft künstlerisch begabt, kunst- und grafikstudiert und damit nicht selten Agentur-inkompatibel) und dem „On- und Offline-Allrounder“, auf dessen persönliches Weiterbildungspotential man sich verlassen konnte und musste.
Der Anfang vom Ende des Branchenhypes war sicher die Entdeckung des Marktes durch die Politik und damit netzwerkend durch das Bildungsträgertum. In großer Verzweiflung nämlich, wie man ein Heer potentiell beschäftigungsloser Leute trotz aller Wahlversprechen in diesem Land in Arbeit bringen und dabei den eigenen Hintern retten könnte, stürzte man sich geradezu wahnhaft und wissentlich am gesunden Konkurrenz-Bedarf vorbei auf eben diese Neuen Medien.
Die Folgen bekam ich selbst erstmals ab etwa 2003 zu spüren, als ich konsequent meine Stundensätze senken musste. Kundenstämme brachen weg, studentisch geprägte Billigfirmen und Ramsch-Freelancer quollen auf den Markt. Der geile Geiz äußerte sich zudem in Heerscharen von Praktikanten, die nun Agenturen und Nicht-Medien-Unternehmen bevölkerten. Warum einen „teuren“ Allrounder bezahlen, wenn es doch ein Praktikant kostenlos macht? Aus der Not machte ich damals eine Tugend und steuerte mitten hinein ins konzeptionelle Marketing. Zumindest das war möglich. Vor kurzem fragte mich ein offenbar supererfolgreicher Firmenchef ungläubig, wie ich mir denn die Kenntnisse ohne Ausbildung im Medienbereich habe aneignen konnte. Ich sagte ihm, dass dies doch ganz einfach und in der Freizeit möglich sei.
Zahllose Berufsausbildungen mit hübschen Bezeichnungen, wie „Mediendesigner“, „Mediengestalter Digital und Print“, „Mediengestalter Bild und Ton“, „Mediafachmann“, „Medieninformatiker“, „Kaufmann Marketing/Kommunikation“, „Kaufmann audiovisuelle Medien“, „Werbekaufmann“, „Gestalter visuelles Marketing“, „Multimedia-Producer“, „Online-Redakteur“ sowie der schon fast altbacken anmutende „Webdesigner“ sollen Vielfalt der Möglichkeiten auf dem heutigen Arbeitsmarkt vermitteln – und dabei sind die genannten nur ein Bruchteil neuer Ausbildungsgänge.
Gewinner dieser Entwicklung sind die eigentlichen „Jobwunder“ unserer Tage: Politik, Hochschulen, Institute, Berufsschulen, freie Bildungsträger und irgendwie auch die Jobcenter, weniger die künftigen Jobaspiranten. Diese vermehren sich massenhaft als Konsumenten jener Suggestion, irgendwann mal „irgendwas mit Medien“ machen und dabei richtig Kohle verdienen zu können. Kürzlich las ich über den Fotojournalisten Rolf Nobel, der im Gespräch mit seinen Studenten sagte: „Keiner von euch wird draußen gebraucht. Ihr bekommt nur Jobs, wenn ihr sie anderen wegnehmt.“ Der Nachschub für den Personalmüll kommt bestimmt.
Doch eines war, ist und bleibt wohl erst einmal so: Kreativität kann man nicht lernen, nicht studieren – sondern man hat sie. Oder auch nicht.